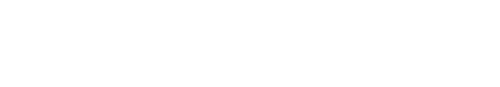4324148
Verkehrsplanung 1
Description
No tags specified
Flashcards by Silas Trachsel, updated more than 1 year ago
More
Less
|
|
Created by Silas Trachsel
over 8 years ago
|
|
Resource summary
| Question | Answer |
| Weg Definition Durchschn. Anzahl Wege p.P. | Ortsveränderung vom Startort zum Zielort mit einem bestimmten Zweck 3.4 |
| Etappe | Abschnitt eines Weges; Änderung der Etappe beim Umsteigen von einem Verkehrsmittel in ein anderes |
| Modal Split Durchschnittliche Werte | 1/3 NMV (zu Fuss 28%, Velo 7%) 1/3 ÖPNV 1/3 MIV |
| Verkehrsmittelwahl: Aufteilung Anzahl Etappen Unterwegszeit Tagesdistanz | 50% der Etappen zu Fuss 40% der Zeit je Fussverkehr/Velo und MIV 65% der Distanz mit MIV, 25% mit ÖV |
| Verkehrszweck in % | Freizeit 40% Arbeit 20% Einkauf 12% |
| Zusammenhang Dichte - Verkehrsverhalten | Je höher die Dichte, desto höher der Anteil des Umweltv. Abnehmende Weglänge mit zunehmender Siedlungsdichte Kürzere Freizeitwege mit zunehmender Siedlungsdichte Höherer Anteil Umweltv. bei gutem Detailhandelsangebot in Fussdistanz |
| Vorteile ÖV | Flächen- und Energiesparsamer geringere Lärm- und Schadstoffemissionen Höhere Verkehrssicherheit Hohe Leistungsfähigkeit |
| Nachteile ÖV | Strecken-, Linien-, Haltestellen-, und Fahrplangebundenheit |
| Voraussetzungen für guten ÖV | Schnelligkeit Sicherheit Sauberkeit |
| Charakteristik ÖV | Jedermann zugänglich Massenproduktion Vorprogrammierung Chauffeur |
| Grundpflichten der ÖV-Betreiber | Betriebspflicht Beförderungspflicht Fahrplanpflicht Tarifpflicht |
| Verkehrsmittel des ÖV | Bahnverkehr Strassengebundener ÖV - Regionaler Personenverkehr Strasse - Ortsverkehr Schifffahrt |
| Ziele der ÖV-Planungen | Erhöhung der Nutzenstiftung für den Benutzer Verbesserung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses Verbesserung der Nutzenstiftung für die Allgemeinheit |
| Definition Tram | schienengebundenes Transportmittel in Stadtverkehr des ÖV, in den Strassenkörper integriert (in oder parallell der Strasse), Schiene kann von MIV befahren werden. Fahren auf Sicht (15-20kmh), Haltestellenabstand 300-700m |
| Definition Stadtbahn Definition Tram-train | Tram mit hohem Anteil an Eigentrassee Stadbahn mit teilweise Mitbenützung von Vollbahnstrecken |
| Tram: Verkehrsraumbreite im Begegnungsfall (+-) | 2W+1m |
| Ausbauform des Tramtrassees (Trennungsmöglichkeiten) | bauliche Trennung (Separate Spur, nicht von MIV befahrbar) räumliche Trennung (von MIV befahrbar) zeitliche Trennung (Tram von MIV durch Signalisation zeitlich getrennt) |
| Unabhängiges Eigentrassee (unabhängiger Bahnkörper) | Strecke völlig vom übrigen Verkehr getrennt |
| Eigentrassee im Strassenraum (besonderer Bahnkörper) | Strecke im Verkehrsraum des restlichen Verkehrs, jedoch durch bauliche Massnahmen getrennt |
| Tram im Mischverkehr (Strassenbündiger Bahnkörper) | Tram nutzt den Verkehrsraum des restlichen Verkehrs ohne bauliche Massnahmen. Es gelten die gleichen Regeln wie für die restlichen Verkehrsteilnehmer |
| Aufgaben Bus | Übernimmt grundsätzlich die FEINVERTREILUNG (in Netzen mit S-Bahn/Tram), in Netzen ohne Schienenverkehr auch die GESAMTERSCHLIESSUNG |
| Charakteristika der Busse | Fahren im Mischverkehr gleichgestellt mit den anderen Fahrzeugen nicht spurgebunden weniger Kapazität als Tram Keinen Einfluss auf das Strassenbild |
| Trolleybus | Bus, welcher elektrische Energie aus einer Fahrleitung entnimmt und auf öffentlichen Strassen verkehrt, ohne an Schienen gebunden zu sein Benötigt die gleichen Verfahren wie Trams (UVEK) |
| Radverkehr auf Busstreifen | Wenn Breite > 3.25m: Kein Problem Zwischen 3-3.25m nur wenn: Nur wenige Busse Nur wenige Fahrräder kleiner Haltestellenabstand grosses Gefälle Nur kurzer Busstreifen |
| Bushaltestellen: Möglichkeiten für behindertengerechten Ausbau | Einstieg mit mobiler Rampe (16cm Kantenhöhe) Niveaugleicher Einstieg (22cm Höhe, 5cm Abstand Bus-Kante) |
| Bushaltestellen: Formen | Volle Haltestellenbucht Schmale Haltestellenbucht Haltestellentasche Haltestellenkap Haltestelle am Fahrbahnrand |
| Leistungsfähigkeit | Grösstmögliche Verkehrsstärke, die einen Abschnitt einer Anlage bei gegebenem Zeitintervall und Strassen-, Verkehrs-, und Betriebsbedingungen durchfahren kann Abhängig von Steigung, Schwerverkehrsanteil Kurvigkeit und Geschwindigkeit |
| Aufbau Strassenquerschnitt | |
| Parkfeld vs. Parkplatz | Parkfeld: Für EIN Fahrzeug Parkplatz: Für VIELE Fahrzeuge |
| Komfortstufen von Parkierungsanlagen | A: Nur für Wohn- und Geschäftshäuser B: Öffentliche Parkhäuser, Parkieren im Strassenraum C: Gewerbebetriebe, Autovermietungen |
| Anordnungsmöglichkeiten von Parkfeldern im Strassenraum | Längsparkfelder auf der Fahrbahn (mit/ohne Abtrennung einzelner Felder) Längsparkfelder neben der Fahrbahn Schrägparkfelder vor dem Gehweg Senkrechtparkfelder hinter dem Gehweg |
| Rampensysteme bei Parkhäusern | |
| Halbrampe | Eignen sich für kleine Umschläge i.d.R. kleinere Parkhäuser |
| Vollrampe | kleinster Platzbedarf pro Parkfläche i.d.R. grössere Parkhäuser |
| Wendelrampe | vertragen den grössten Umschlag Hohe Kosten neben (Gegenverkehrs-)wendelrampen sind auch Doppelgängige Möglich |
| Grundmasse RV | Normaler Velostreifen: 1.5m |
| Anteil der Etappen des Fussverkehrs | |
| G | 1m Breite für 1 Person 1.5-2.5m für 2 Personen Bsp.: 2m für Gehweg, 0.5m für Laterne |
| Definition Verkehr | Verkehr ist die AKTIVE Ortsveränderung von Personen, Gütern, Informationen und Energie. Man unterscheidet den privaten oder individuellen (IV) und den öffentlichen Verkehr (ÖV). |
| Transport | Transport ist die PASSIVE Ortsveränderung von Personen und Gütern |
| Verkehrsmittel | motorisierte Verkehrsmittel nichtmotorisierte oder Langsamverkehrsmittel |
| Mobilität | Die Fähigkeit zur Ortsveränderung |
| Räumliche Mobilität | Beweglichkeit von Personen und Gütern im geographischen Raum |
| Verkehrsplanung | Prüfung der Notwendigkeit, der vorausschauenden Bereitstellung und dem Betrieb der für den Verkehr und Transport nötigen Infrastruktur |
| Definition Integrierte Verkehrsplanung | ... ist eine nachhaltige, aufeinander abgestimmte Planung von Siedlungs- und Verkehrsstrukturen |
| Aufgabe zu Bewegungsgleichungen und Beschleunigung lösen | Skript VP II Register IJ |
| Drei Hauptziele der integrierten Verkehrsplanung (3V-Strategie) | Vermeiden Verlagern Verträglicher machen |
| 3V-Strategie: Vermeiden | Verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen schaffen: Ausgewogene Mischungen von Wohnen und Arbeit Kurze Wege schaffen |
| 3V-Strategie: Verlagern | Attraktive Bedingungen zum Umstieg auf verträglichere Verkehrsmittel Angebotsverb. des Umweltverb. Restriktive Massnahmen für MIV Kostenwahre Preise im mot. Verkehr Verbesserung der Aufenthaltsqual. |
| 3V-Strategie: Verträglicher machen | Beschränkung der MIV-Flächen (ruhend und fahrend) Niedriggeschwindigkeitskonzepte Mehr Flächen für LV |
| Push-Massnahmen | Parkplatzreduzierung und Zufahrtsbeschränkungen in Innenstädten Verkehrsberuhigung Geschwindigkeitsbeschränkungen Mautpflicht |
| Pull-Massnahmen | Vorrang für Busse und Bahnen Taktverkürzung Tarifvereinheitlichungen und -senkungen Komfort, Service, Sicherheit Park und Ride Bike und Ride |
| Grundsätze und Prinzipien der VP | Achsen-Kammern-Prinzip Niedriggeschwindigkeitsansatz Koexistenzprinzip Integrationsansatz |
| Achsen-Kammern-Prinzip | Vermeiden des quartierfremden mot. Verkehrs Bündelung des quartierfremden Verkehrs auf den Hauptachsen Bildung verkehrsberuhigter Kammern unter Einbezug der Sammelstrassen --> Verkehrs- & Erschliessungskonzepte |
| Niedriggeschwindigkeitsansatz | Reduktion der Fahrtgeschwindigkeiten Erhöhung der Verkehrssicherheit Verminderung der Umweltbelastungen Verringerung des Flächenbedarfs im mot. Verkehr --> Tempobeschränkte Zonen/Strassen |
| Koexistenzprinzip | Berücksichtigung aller Verkehrsarten Gegenseitige Rücksichtnahme Verbesserung der Bedingungen des nichtmot. Verkehrs --> Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit |
| Integrationsansatz | Städtebauliche Integration der Strassenräume Rückgewinnung von Fahrbahnflächen für den Aufenthalt Mehr Wohnlichkeit Verbesserung des Stadt- und Ortsbildes --> Strassenraumgestaltung |
| Ziele von Tempo 30 | Homogenisierung des Verkehrsablaufes Weniger Luft- und Lärmbelastungen Mehr Verkehrssicherheit Höhere Aufenthaltsqualität Weniger Flächen für den mot. Verkehr |
| Wirkungen verkehrsberuhigender Massnahmen | Rückgang der Unfallschwere Weniger Umweltbelastungen Geringerer Flächenbedarf Bessere Wahrnehmung Identitätsgewinn Netzwirkung KEINE Einschränkung der Leistungsfähigkeit, KEIN Zeitverlust |
| Oberziele der Verkehrserschliessung | Wohnlichkeit Bedienungsgüte Sicherheit Wirtschaftlichkeit |
| Netzformen für grosse Wohnquartiere | Rasternetz achsiales Netz Verästelungsnetz Innenringnetz Aussenringnetz |
| Vorteile Rasternetz | kurze Wege für alle Verkehrsarten Flexibilität bei Störungen Viele Netzelemente für ÖV geeignet einfache Orientierung Eck- und Platzbildungen möglich gleichmässige Verteilung der Verkehrsbelastungen |
| Nachteile Rasternetz | Verteilung des MIV schwer zu beeinflussen Schleichverkehr möglich bei geringer Maschenweite aufwendige Doppelerschliessung |
| Vorteile achsiales Netz | direkte Strassenführung einfache Orientierung günstige Erschliessung durch ÖV möglich |
| Nachteile achsiales Netz | Trennwirkung der zentralen Sammelstrasse Schleichverkehr bei beidseitigem Anschluss möglich |
| Vorteile Verästelungsnetz | kein Schleichverkehr auf der Sammelstrasse Wege gut für LV verlängerbar |
| Nachteile Verästelungsnetz | Lange Wege für MIV im Binnenverkehr Möglichkeit von Stau im Knotenbereich Ungünstige ÖV-Erschliessung |
| Vorteile Innenringnetz | Gute ÖV-Erschliessung Gute Erschliessung zentraler Einrichtungen Fahrverkehrsfreie Zone im Zentrum möglich |
| Nachteile Innenringnetz | Trennwirkung der Sammelstrasse Staugefahr im Zentrum geringe Knotenpunktabstände an der Sammelstrasse |
| Vorteile Aussenringnetz | stark belastete Sammelstrasse ist am Rand Wege gut für LV verlängerbar |
| Nachteile Aussenringnetz | Zentrale Einrichtungen nur über Anliegerstrassen möglich Trennwirkung der Sammelstrasse Erschliessung mit ÖV unwirtschaftliche Erschliessung lange Wege mit MIV im Binnenverkehr |
| Netzformen für kleine Wohnquartiere | Rasternetz mit ... ...Schleifen- und Stichstrassen ...Schleifenstrassen im Einbahnverkehr ...Umgestaltungen im Strassenraum |
| Vorteile Stichstrasse | Hohe Wohnlichkeit Hohe Verkehrssicherheit Wendeflächen für Platzgestaltung & Erschliessung |
| Nachteile Stichtrasse | Wendevorgänge für MIV Umwege für Versorgungsfahrzeuge Flächenverbrauch für Wendeanlagen Nur ein Anschluss an höherrangige Strasse |
| Vorteile Schleifenstrasse | Selten Fremdverkehr Hohe Wohnlichkeit zwei Anschlüsse an höherrangige Strasse |
| Nachteile Schleifenstrasse | teuer wegen grossem Anteil an Doppelerschliessungen Kann als Umfahrungsroute für stark belastete Knoten genutzt werden (Schleichverkehr) |
| Vorteile Einhangstrasse | Keine Umwege zwei Anschlüsse an höherrangige Strassen Keine Wendefahrten |
| Nachteile Einhangstrasse | Keine Verhinderung von Schleichverkehr Doppelerschliessungen bei kurzen Einhangstrassen |
| Einflussgrössen auf das Verkehrsaufkommen | Das Verkehrsaufkommen eines Gebietes hängt ab von • der Raum- und Siedlungsstruktur, • dem Verkehrsangebot • den verkehrsrelevanten Verhaltensweisen der Bevölkerung |
| Begegnungsfall LW/LW | |
| Begegnungsfall LW/MIV | |
| Begegnungsfall MIV/MIV | |
| Begegnungsfall MIV/RV | |
| Vorgehen zur Raumaufteilung | |
| Bauliche Elemente der Verkehrsberuhigung | Einengungen Horizontaler Versatz Vertikaler Versatz Kissen |
| Emission | Aussendung von Störfaktoren (Schadstoffe) in die Umwelt |
| Immission | Einwirkung von Störfaktoren aus der Umwelt |
| Luftschadstoffe | Stickstoffdioxid Kohlenmonoxid Kohlendioxid Russpartikel/Feinstäube Schwefeldioxid Blei Ozon Leicht flüchtige Kohlenwasserstoffe VOC |
| CO2-Emissionen: Tendenz Anteil Verkehr | Im Gegensatz zu allen anderen Luftschadstoffen weiter zunehmend Anteil Verkehr: Ca. 1/3 |
| Lärmschutz: Empfindlichkeitsstufen | In Lärmschutzverordnung LSV: |
| Lärmschutzmassnahmen | 1 = aktiver Lärmschutz an der Quelle 2 = Lärmschutzwände 3a = lärmgünstige Anordnung von Wohnungen 3b = Schallschutzfenster |
| Flächenverbrauch im Verkehr | ca. 150m2 |
| Faktoren zur Stärke der Trennwirkung | • Lage (Linienführung, Damm, Einschnitt) • Verkehrsfrequenzen (Verkehrsbelastungen) • Breite • Geschwindigkeit der Fahrzeuge • Potentielle Gefährdung (Querbarkeit...) |
| Verminderung der Trennwirkung durch | • mehr und sicherere Querungsmöglichkeiten • Reduktion der Fahrbahnbreite • Gestaltungsmassnahmen • Geschwindigkeitsreduktion |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.