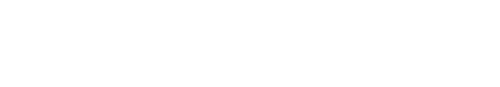1048309
BiWi, Erziehung
Resource summary
| Question | Answer |
| Was ist der Unterschied zwischen Pädagogik, EW und BiWi? | Pädagogik hat einen personaleren Bezug, EW hat eine eher empirische Komponente, BiWi ist interdisziplinär und vereint Theorie und Praxis innerhalb und außerhalb von Institutionen. |
| Nenne Teildisziplinen der BiWi! | Erwachsenenbildung, Sonderpädagogik, Medienpädagogik, Schulpädagogik etc. |
| Nenne forschungsorientierte Unterteilungen der BiWi! | Historische Bildungsforschung, international und interkulturell vergleichende EW, empirische Bildungsforschung, Schulpädagogik, Sonderpädagogik etc. |
| Nenne Praxisfelder der BiWi! | Schulen, Beratungsstellen, Betriebe, VHS etc. |
| Geschichte der BiWi Antike bis 19./20. Jhd. | Antike: Erziehung/Bildung als theoretisch-philosophische Reflexion; 1779: Pädagogik als Universitätsfach; Bedeutungszuwachs wg. Institution Schule u. Aufklärung; 1806: erste Systematisierung durch Herbart; 1813/14: Schleiermacher; 1888: Dilthey; Professuren meist mit Philosophie, Psychologie, Philologie gekoppelt; Rahmen: Lehrerbildung |
| Geschichte der BiWi bis heute | Einzeldisziplin an Unis; von 38 Professoren (nach 2. WK) bis knapp 1000 (1984); "Pädagogik" bis 19./20. Jhd., "EW" zunehmend in 1960er; Brezinka fordert empirisch-analytische statt hermeneutische Methode; 2 Forschungsrichtungen: philosophisch-reflexiv (Sinn, Bedeutung) u. empirisch-positivistisch (beobachtbar) |
| Beschreibe die theoretisch-philosophische Perspektive! | Die theoretisch-philosophische Perspektive schließt kritisch-analytische, hermeneutische oder phänomenologische Reflexionen ein z.B. anthropologische u. soziokulturelle Voraussetzungen, Beweisverfahren, ökonomisch-politische Bestimmungen. |
| Beschreibe die empirisch-erziehungswissenschaftliche Forschung! | Es ist die methodische Herstellung von Wissen über Wirklichkeitsbereiche für kausal-analytische Zusammenhänge z.B. Untersuchung von Bildungssystemen, historische Materialien, Biographien. |
| Was ist Wissenschaft? | Wissenschaft versucht Phänomene und Zusammenhänge verstehbar und erklärbar zu machen; Aussage über Gegenstandsbereich; Zugriff methodisch gelenkt (empirisch, hermeneutisch-kritisch); Orientierung an Paradigmen; kontinuierliche Weiterentwicklung über Revisionsprozesse; fortschreitende Annäherung an sog. Wahrheit |
| Was sind Paradigmen (in der BiWi)? | allgemeingültig herrschende Voraussetzungen (z.B. Mensch ist "Gottesknecht", Mensch ist "Selbstliebhaber"; aktuell: Orientierung an säkularisierter Weltdeutung, kritisch-aufgeklärter Ethos) |
| Theorie | Zusammenhang von Vorstellungen und ihren Begründungen |
| Theorie in der BiWi | Abgrenzung von Phänomenen untereinander, Verstehen der pädagogischen Dimension |
| Unterschied zwischen Meinen, Glauben, Wissen | Meinen: keine Sicherheit, keine Erwartungshaltung zur Zustimmung; Glauben: stärkere Überzeugung, subjektiv, nicht belegbar; Wissen: im Anspruch objektiv gewiss; wissenschaftl. Wissen: intersubjektiv begründbar, auf Zustimmung der wissenschaftlichen Gemeinschaft angewiesen |
| pädagogisches Alltagswissen | einziges Geltungskriterium ist Beitrag zur Bewältigung des Alltags (Laienwissen), Begründung ist die eigene Sozialisation, Familie, Freunde, Medien |
| Professionswissen | Voraussetzung: Studium, Erwerb im Berufsalltag, Problemlösung vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Konzepte |
| wissenschaftliches Wissen in der Bildung | Erwerb in der Beschäftigung mit der Wissenschaft von Bildung; Voraussetzung für Professionswissen; kritisch-analytisch; schafft Distanzen, die für eine reflektierte Sicht der Praxis notwendig sind |
| Was sind Grundbegriffe (in der BiWi)? | Begriffe, die in der Wissenschaft selbst nicht mehr abgeleitet werden; zentrale ordnungs- und sinnstiftende Kategorien der Theoriebildung; Festlegung durch ständige Ableitung auf diese Begriffe im Rahmen der bildungswissenschaftlichen Diskurse; Fassung von Problemfiguren; Begründung und Abgrenzung von nicht theoretisch fundierten Verwendungsweisen; (BiWi: Erziehung, Bildung, Sozialisation) |
| Erziehung - verbreitete allg. Vorstellung | gelungene Integration in Gesellschaft und Kultur; Ausgleich von Defiziten; Korrektur; Stabilisierung von Welt, Gesellschaft, Kultur |
| Erziehung - Ansätze: Arendt | Erziehung als permanente Erneuerung der Welt, konservative Erziehung zum Schutz des Alten vor dem Neuen und umgekehrt |
| Erziehung - Ansätze: Bernfeld | Reproduktion von Gesellschafts- und Machtstrukturen, Reaktion der Gesellschaft auf Entwicklungstatsache |
| Erziehung - Ansätze: Kant | Paradoxon Freiheit (Selbständigkeit und Neues) vs. Zwang (Grenzen, Regeln, Unterordnung) |
| Erziehung - Ansätze: Adorno | Förderung der kritischen Selbstreflexion und Autonomie, Bewegen zur Mündigkeit |
| Problematik der Erziehung | kein verlässlicher Intention-Wirkung-Übergang, Mensch kann nicht erzieherisch nach Plan geformt werden; Perspektive Erzieher-Erziehender unterschiedlich, Fertiges trifft auf Werdendes (s. Kafka "Hand" und "Material"), oft Erfahrung als Machtverhältnis (auch Willkür) |
| Erziehungsbegriff in Abgrenzung zum Bildungsbegriff | Erziehung: Verbindung mit Zucht, Disziplin, Unterordnung, Einordnung, Eingewöhnung, Kultivierung, Zivilisierung, Anpassung, machtstrukturiertes Verhältnis unter Maßgabe der Förderung Bildung (in Abgrenzung): mündige Lebensführung, Selbstgestaltung |
| Erziehung - Herleitung | jüdisch-christl. "musar": Zucht und Disziplinierung mit dem Ziel uneingeschränkten Gehorsams; griechisch "paideia": freie Selbstentfaltung |
| Erziehung - Spannungsfelder | Zwang/Freiheit, Fremd-/Selbstbestimmung |
| Erziehung - Rahmen | hierarchisch höherstehende Instanz (z.B. Gott, Familie etc.) |
| implizite Anthropologeme | bestimmen herrschende Vorstellungen vom Menschen insbes. vom Kind; im Kontext von anthropologischen Fiktionen von Mensch, Gesellschaft, Kultur und Welt; gebunden an historische Vorstellungen und alltägliche Erfahrungen; Basis für Erziehungsmetaphoriken |
| implizite Anthropologeme - Rousseau | Mensch ist von Natur aus gut, Gesellschaft und Zivilisation verderben ihn |
| implizite Anthropologeme - Pestalozzi | Mensch ist von Natur aus "träg, unwissend, unvorsichtig, unbedachtsam, leichtsinnig, leichtgläubig, furchtsam und ohne Grenzen gierig" und in der Folge "heimtückisch, misstrauisch, gewaltsam, rachgierig, grausam" |
| implizite Anthropologeme - Herder | Mensch unterliegt der Vernunft, Freiheit und Humanität, "er kann forschen, er soll wählen" |
| Erziehungsmetaphorik "Wachsenlassen" | Gärtner - Pflanze: natürliche Anlage und Entwicklung des Menschen, in die erzieherisch eingegriffen werden muss; Verbesserung der Natur/des Menschen |
| Erziehungsmetaphorik "Führen" | Hirte ("Anwalt des Kindes") - Geführter (hilflos): Unterordnung zum eigenen Wohle, Schutzfunktion, ausschließlich hierarchisch, Zögling hat blind und auch gegen seinen Willen zu folgen |
| Erziehungsmetaphorik "Prägen und Füllen" | Belehrender - leeres Blatt, Gefäß: Zeitfenster für bestimmte Prägung, Prägephasen; Inhalt entstammt 100% dem Erzieher |
| Erziehungsmetaphorik "Schöpfung und Zeugung" | Schöpfer - Träger einer heilsversprechenden, besseren Zukunft (auch: Architekt, Baumeister - Werk): Zeugung einer neuen Generation (Schleiermacher); Zeugung des Schönen, Hinlenkung zur Wahrheit (Platon); Zögling trägt Wunsch nach Wissen in sich, Erzieher muss die Wahrheit herausziehen (Sokrates); Reformpädagogik: Anspruch eines Neuen Menschen (Key); Erzieher "schafft" das gut erzogene sittliche Kind |
| Erziehungsmetaphorik "Licht und Erweckung" | Aufklärer - Geschöpf Gottes: Erkenntnis, Wahrheit; Zögling trägt Möglichkeit zur Erkenntnis in sich, Licht muss entzündet werden; mitunter indoktrinär ("richtige" Wahrheit) |
| Erziehungsmetaphorik "Zähmen und Disziplinieren" | Disziplinierender - Mensch im Naturzustand, Tier: Natur muss beherrscht und gebrochen werden, Kultivierung, Triebe/Begierden steuern und beherrschen, Körper wird zum Medium der Disziplinierung, Gehorsam ggü. Regeln/Normen/Gesetzen, Funktionieren als gesellschaftl. Glied; in der Praxis: drastische Strafen zur Brechung des Eigenwillens |
| Erziehungsmetaphorik "Spiel und Regeln" | Schiedsrichter: Einübung von Spielregeln, Spielraum für freiheitl. Entscheidungen, Regeln als Subjekt des Erziehens (entspricht Kontrollgesellschaft) |
| normative Implikationen und ihre Problematik | Unterordnung unter Kultur, Gesellschaft, Tradition, Gebot Gottes usw.; müssten expliziert statt als gegeben angenommen zu werden (Reflexion über Machtstrukturen und unterschiedl. Praktiken der Disziplinierung) |
| funktionale Erziehung + Fragestellung | nicht intendierte Einflüsse z.B. Gesellschaft, Medien, Freunde; Ist Erziehung Absicht oder Wirkung? |
| intentionale Erziehung + Fragestellung | absichtsvolles Tun; Können Erzieher ihr gesamtes Handeln explizieren? Was ist mit Absicht/Methoden ohne Wirkung? Was ist mit nicht-intendierten Folgen? |
| Möglichkeit der Differenzierung in der Erziehung (Begriff) und Probleme | nur beobachtbare Wirkung in Ursache-Wirkungs-Relation (planvolles Unternehmen ausgeschlossen, da Wirkungsbetrachtung vor Intentionsbetrachtung); Probleme: unerwünschte Wirkungen, Legitimation des Gewünschten |
| intentionale und funktionale Erziehung im Zusammenhang | in Absicht-Wirkung Differenzierung von Subjekt-Objekt: wissenschaftstheoretisch nicht zwei Begriffe, sondern unterschiedl. Perspektiven (intersubjektive Nichttrennbarkeit) |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.