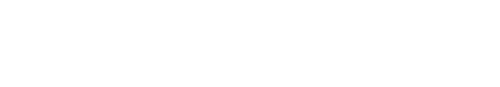7493673
Schulpäd
Description
No tags specified
Flashcards by Rick Tobias, updated more than 1 year ago
More
Less
|
|
Created by Rick Tobias
about 7 years ago
|
|
Resource summary
| Question | Answer |
| Ansatz von Klafki | Materiale Bildung + Formale Bildung (Inhalte) (Fähigkeiten) = Kategoriale Bildung |
| Ansatz von Klafki: Kategoriale Bildung | Zwei konstruktive Momente: Einsicht in den Zusammenhang, Aspekt, Dimension der Wirklichkeit Neue Zugangsweise, Strukturierungsmöglichkeit, Handlungsperspektive |
| Didaktische Analyse bei Klafki | Exemplarische Bedeutung Gegenwartsbedeutung Zukunftsbedeutung Struktur des Inhalts Zugänglichkeit bzw Darstellbarkeit |
| 5 Mediendidaktische Konzepte | Lehrmittelkonzept Arbeitsmittelkonzept Bausteinkonzept Systemkonzept Lernumgebungskonzept |
| 5 Konzepte der Medienerziehung | Behütend-pflegende Medienerziehung Ästhetisch - kulturorientierte '' Funktional-systemorientierte'' Kritisch- Materialistische '' Handlungs- und Interaktionsorientierte " |
| Kritik an Klafki | Bildungsbegriff nur formal, aber nicht inhaltlich festgelegt - Methodische Fragen des Unterrichts werden ungenügend berücksichtigt - Historische Bedingungen werden erkannt, ideologische finden aber zu wenig Beachtung - Empirische Fundierung fehlt - Lehrerpersepktive zu stark betont |
| Unterrichten aus Sicht der unterrichtsanalytischen Ansätze --> Prinzipien der Unterrichtsplanung | Interdependenz Variabilität Kontrollierbarkeit |
| Nenne drei Neuerungen der Kritisch-konstruktiven Didaktik von W.Klafki 1985. | Thematisierung der gesellschaftlichen Dimension Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs und Solidaritätsfähigkeit als Ziele Polit. Programm zur Demokratisierung von Bildung und Schule Lehren + Lernen= Interaktionsprozess Entdeckendes + sinnhaft- Verstehendes Lernen anhand exemplarischer Themen |
| Klafki 1985 erweitert die „Didaktische Analyse“ zum Perspektivenschema zur Unterrichts- planung. Welche Dimensionen werden dabei hinzugefügt? | Bedingungsanalyse Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit Lehr-Lern-Prozessstruktur |
| 3 Grundaufgaben einer konstruktivistischen Didaktik: • Reich | Konstruktion • Rekonstruktion • Dekonstruktion |
| Didaktisches Reflexionsfenster Reich Handlungsformen der Grundaufgabe einer konstruktivistischen Didaktik | Konstruieren: Erfinden, Begründen; Gestalten Rekonstruieren: Entdecken Verallgemeinern ,Erfahren Dekonstruieren: Enttarnen Zweifeln Kritisieren |
| Kritikpunkte an der konstruktivistischen Didaktik nach Reich | Gesellschaftlich relevante Wissensbestände des Entdecken-Lassens nicht in angemessener Zeit erworben werden • Notwendigkeit der Verbindung von systematischem Wissenserwerb und situativem Lernen • Frage der Feststellung und Beurteilung von Lernleistungen |
| Anspruch, den unterrichtsanalytische Ansätze, z.B. der von Heimann (1962) bzw. Schulz | relevante Strukturelemente des Unterrichts sowie ihre Beziehungen zu erfassen und theoretisch zu durchdringen |
| Welche zwei Reflexionsstufen gibt es nach Heimann (1962)? Berliner Modell | Strukturanalyse Bedingungsprüfung |
| Bitte nennen Sie die sechs formal konstanten, inhaltlich jedoch variablen „Elementar- Strukturen“ der Strukturanalyse nach Hermann. Berliner Modell | Entscheidungsfelder: Internationalität Inhaltlichkeit Methoden-Organisation Medien-Abhängigkeit Bedingungsfelder: Anthropologische Determinanten Sozial-kulturelle Determinanten: |
| zweite Reflexionsstufe nach HeimannBerliner Modell | Bedingungsprüfung : Normenkritik: Faktenbeurteilung: Formenanalyse: |
| Kritik unterrichtsanalytischen Ansatz von Hermann Berliner Modell | • Postulat der wertfreien Beschreibung kann zur Ideologieanfälligkeit führen • zustarkeBetonungderPerspektivederLehrperson • Fokus:Unterrichtsanalyse • KeineHilfenfürkonkreteUnterrichtsplanung |
| Ziel und Forderung des Hamburger Modells? | Forderung: Beteiligung aller Betroffenen an der Unterrichtsplanung Ziel: Emanzipation |
| Vier Phasen der Unterrichtsplanung im Hamburger Modell | Perspektivplanung( für einen längeren Zeitraum) • Umrissplanung einer Unterrichtseinheit • Prozessplanung des Unterrichts • Laufende Planungskorrektur |
| Grundlage Konstruktivismus | Lernen als eigenaktiver Aufbau kognitiver Strukturen durch Schülerinnen und Schüler |
| Auf welchen gesetzlichen Grundlagen basiertes Recht auf schulische Inklusion? | 2009 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 2011 Bay. Erziehungs- und Unterrichtgesetz (EUG) |
| Welche Formen von Integration können unterschieden werden? Charakterisieren Sie bitte die beiden Möglichkeiten kurz! | Bedingte Integration Integration ist an Bedingungen geknüpft Integration je nach individuellen, personellen, räumlichen, zeitlichen Voraussetzungen □ Additives Vorgehen: Einzelne Kinder mit Förderbedarf werden in Regelschulen eingegliedert Unbedingte Integration □ Integration als Grundrecht □ Separation wird ausgeschlossen □ Feuser (1989): „gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nicht-behinderter Kinder und Jugendlicher“ |
| Was ist Inklusion | „Unter Inklusion wird die gleichrangige gesellschaftliche Partizipation aller Menschen, einschließlich derjenigen mit Behinderungen unter Gewährung dafür notwendiger Hilfen verstanden.“ |
| Was ist Integration | Einbezug aller Heterogenitätsdimensionen • Systembezogene Sichtweise • Rechtlicher Anspruch |
| Bitte zeigen Sie die vier Begründungslinien für Inklsuion auf | Demokratieorientierte Begründungslinie Menschenrechtorientierte Bildungsökonomische Pädagogisch-Psychologische |
| Unterrichtsformen in Bayern – kooperatives Lernen | kooperationsklassen ,Partnerklassen, Offene Klassen an der Förderschule |
| Unterrichtsformen in Bayern – Formen der inklusiven Schule in Bayern | Einzelintegration Schulen mit dem Schulprofil „Inklusion“ |
| Bausteine inklusive Didaktik nach Reich | - Beziehungen und Teams - Demokratische und Chancengerechte Schule - QualifizierendeSchule - Förderliche Lernumgebung • Ganztag mit Rhythmisieren -->multiperspektivisch, multimodal, multiproduktiv |
| Differenzierung nach Wiater (2014). Gehen Sie dabei auf die beiden Arten von Differenzierung ein, die dieser unterscheidet. | • ÄußereDifferenzierung Interschulisch Intraschulisch • InnereDifferenzierung Individualisierung Einteilung in kleinere Lerngruppen |
| Formen innerer Differenzierung nach Wiater | • ÄußereDifferenzierung Interschulisch- Intraschulisch • InnereDifferenzierung Individualisierung- Einteilung in kleinere Lerngruppen |
| Unterricht aus der Sicht handlungsorientierter Ansätze --> Anspruch: | • Orientierung am Handeln der Lernenden • Bedeutsamkeit für gegenwärtiges und zukünftiges Handeln |
| Nennen sie die vier Aufgabentypen, von Tulodziecki/ | Komplexe Probleme: Komplexe Entscheidungsfälle Komplexe Gestaltungsaufgaben Komplexe Beurteilungsaufgaben: |
| Merkmale lernprozessanregender Aufgaben nach Tulodziecki | Verständlichkeit • Situierung • Bedeutsamkeit • Neuigkeitswert • angemessenerSchwierigkeitsgrad • Eignung zur exemplarischen und handlungsrelevanten Erschließung eines für die Gegenwart oder Zukunft bedeutsamen Unterrichtsinhalts |
| Nennen Sie bitte die acht Unterrichtsphasen eines handlungsorientierten Unterrichts. | 1.Aufgabenstellung und spontane Lösungsvorschläge 2. Zielvereinbarung und Bedeutsamkeit 3. Verständigung über Vorgehen 4. Erarbeitung von Grundalgen für die Aufgabenlösung 5. Aufgabenlösung 6. Vergleichen und Zusammenfassen 7. Anwendung 8. Weiterführung und Bewertung |
| Welche computerbasierten Angebote lassen sich nach Tulodziecki/ Herzig/ Grafe 2010 unterscheiden? | • Lehrprogramme • Offene Lehrsysteme • Übungsprogramme • Lernspiele • Experimentier- und Simulationsumgebungen • Datenbestände • Werkzeuge • Kommunikations- und Kooperationsumgebungen |
| Nennen Sie bitte die drei grundsätzlich zu unterscheidenden lehr-lerntheoretischen Grundpositionen und charakterisieren Sie diese kurz. | 1. Behavioristische Grundposition: Steuerung des Lernens durch Hinweisreize und Verstärkungen 2. Kognitionstheoretische Grundposition:• Aufbau von Wissensstrukturen • Entwicklungstheoretische Ansätze 3. Konstruktivistische Ansätze: Lernen als subjektive Konstruktion von Wirklichkeit auf der Basis individueller Wahrnehmung |
| Bitte nennen und charakterisieren Sie kurz die mediendidaktischen Ansätze, | 1. Lehrmittelkonzept(Präsentationsfolie, kurze Animation, Bildtafel, Landkarte) 2. Arbeitsmittelkonzept (Arbeitsblatt, Informationsquelle, einfache Form eines Webquests, Übungsprogramm) 3. Bausteinkonzept (Lehrfilm, Schulfernsehsendung, Lehrprogramm zu einem begrenzten Inhaltsbereich, Videopodcast) 4. Systemkonzept (Medienverbundsystem, Online-Kurs, Lehrprogramm zu einem größeren Themenbereich) 5. Lernumgebungskonzept(Simulationsumgebung, virtuelles Labor, Datenbestände mit Kommunikations- u. Kooperationsumgebung) |
| Funktionen von Medien im Unterrichtsablauf | Präsentation von Aufgabenstellungen • Instrument der Planung • Informationsquelle • Lernanregung bzw. Lernhilfe • Werkzeug für die Be- und Verarbeitung von Daten • Gegenstand von Analysen • Instrument der Kommunikation und Kooperation • Instrument der Speicherung und der Präsentation von Arbeitsergebnissen |
| Medienbegriff | Enger Medienbegriff: Übertragung, Speicherung, Präsentation, Verarbeitung, Arrangement potenzieller Zeichen mit Hilfe technischer Geräte Weiter Medienbegriff: Form, in der ein Inhalt präsentiert wird |
| Erfahrungsformen bzw. Medien: Reduktions- grade | • reale Form • modellhafte Form • abbildhafte Form – realgetreu oder abbildhaft-schematisch • symbolische Form – verbal oder nonverbal |
| Schulart- und fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele | Interkulturelle Bildung Sprachliche Bildung Werte- Erziehung Interkulturelle Bildung Soziales Lernen |
| Teilgebiete der Medienpädagogik | Mediendidaktik - Theorie der Medienerziehung |
| fünf Konzepte der Medienerziehung | • Behütend-pflegende Medienerziehung • Ästhetisch-kulturorientierte Medienerziehung • Funktional-systemorientierte Medienerziehung • Kritisch-materialistische Medienerziehung • Handlungs- und interaktionsorientierte Medienerziehung |
| Nennen Sie bitte die fünf Aufgabenbereiche der Medienerziehung. | • Auswählen und Nutzen von Medienangeboten • Gestalten und Verbreiten eigener medialer Beiträge • Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen • Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen - Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung |
| Grundsätze für ein medienpädagogisches Konzept | • Kontinuierlicher Prozess über mehrere Jahrgangsstufen • Einbezug mehrerer/aller Fächer • Orientierung an Aufgabenbereichen • Beachtung des gesamten Medienspektrums • Berücksichtigung der altersspezifischen Mediennutzung |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.
Similar
Chemistry GCSE Review - States of Matter, Particles, Atoms, Elements, Compounds and Mixtures
Morgan Overton